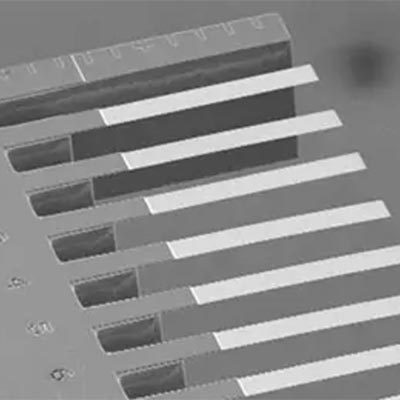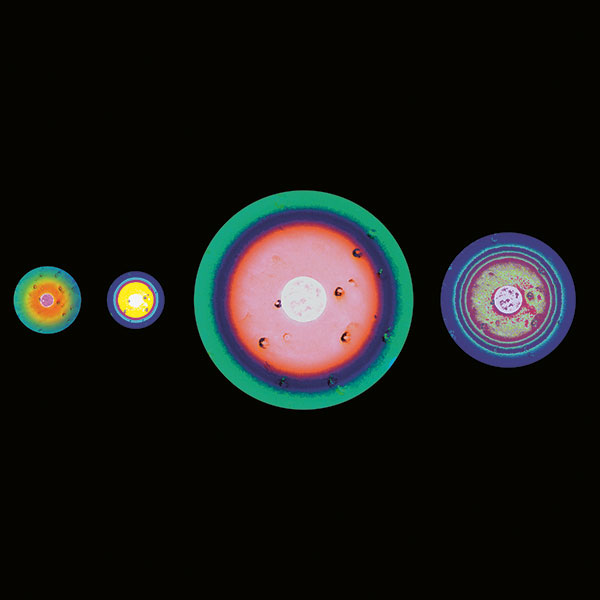ANTIBIOTIKARESISTENZ
Bakterien-bekämpfende Viren werden kaum angewendet
Bei multiresistenten Infektionen hilft manchmal nur noch die Therapie mit Phagen. Doch bei der Zulassung von Präparaten mit den bakterienbekämpfenden Viren hapert es in der Schweiz. Eine Suche nach Lösungen.

Wie Raumschiffe landen die Phagen auf einer Bakterie, injizieren ihre DNA und vermehren sich darin. | Foto: iStockphoto
«Ich hatte mich an Exit gewandt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, so weiterzuleben», erinnert sich José-Maria Vidal in einem Film der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz. Monatelang lag er in einem Genfer Spital, ans Bett gefesselt von einer chronischen Lungeninfektion. Kein Antibiotikum konnte ihm helfen.
Seine Geschichte ging 2023 durch die Schweizer Medien. Denn statt eines begleiteten Suizids nahm sein Schicksal eine überraschende Wende: Dank der Entschlossenheit seines Arztes erhielt er Zugang zu der in der Schweiz nicht zugelassenen Phagentherapie. Dank der Viren, die die Bakterien in seiner Lunge bekämpften, ging es ihm nach nur drei Tagen spürbar besser. Neun Wochen später war er wieder zu Hause. Hinter Vidals Story steckt laut WHO «eine der grössten Bedrohungen für die menschliche Gesundheit»: multiresistente Bakterien, die gegen gängige Antibiotika unempfindlich geworden sind.
3500 Tote pro Tag wegen wirkungsloser Antibiotika
Für Betroffene bedeutet das monatelange Spitalaufenthalte, angeschlossen an Dauerinfusionen mit immer höheren Dosen oder Mischungen verschiedener Antibiotika. Ein Leidensdruck, der für Gesunde kaum vorstellbar ist – und nicht immer so glimpflich endet wie bei Vidal. In der Schweiz stirbt jeden Tag etwa eine Person an den Folgen solcher Infektionen, weltweit sind es fast 3500 – Tendenz steigend.
Phagen, ausgeschrieben Bakteriophagen, gelten für viele als Hoffnungsträger im Kampf gegen die resistenten Keime. Sie befallen ausschliesslich Bakterien, schleusen ihr Erbgut in die Einzeller ein, vermehren sich in ihrem Inneren und bringen sie schliesslich zum Platzen. Für Menschen sind sie ungefährlich, weil sie nur bestimmte Bakterien angreifen. Nützliche Mikroben im Körper bleiben verschont – ganz im Gegensatz zu Antibiotika, die auch die gute Flora zerstören.
Die mikroskopischen Ninjas kommen überall vor, wo Bakterien leben. In Seen, Böden oder Kläranlagen ist die Konzentration besonders hoch. Forschende können Phagen so direkt aus der Umwelt isolieren, ihre Wirkung im Labor prüfen und sie für den medizinischen Einsatz aufbereiten. «Heureka!», könnte man meinen. Dennoch ist in der Schweiz die vielversprechende Therapie nur schwer erhältlich.
Offiziell gilt die Behandlung mit Phagen hierzulande als experimentell. Sie darf nur in Notfällen eingesetzt werden – bei lebensbedrohlichen Erkrankungen ohne Alternative, wie bei Vidal. Die Betonung liegt dabei auf Einzelfall. «Sobald ein Arzt die Behandlung mehrfach beantragt, wird es schwierig», konstatiert Christian van Delden, Infektiologe an den Universitätsspitälern Genf, der Vidal behandelte. «Wiederholte Anwendungen gelten nicht mehr als individueller Heilversuch, sondern als Forschung am Menschen – und müssen von Ethik- und Arzneimittelkommissionen bewilligt werden.»
Für eine reguläre Zulassung fordert die zuständige Behörde Swissmedic den Nachweis der Wirksamkeit in klinischen Studien sowie eine Produktion nach der internationalen Good Manufacturing Practice (GMP). Beides ist bislang ein Hindernis. Studien scheitern oft daran, dass Phagen sehr spezifisch sind. Für statistisch belastbare Zahlen gibt es daher meist zu wenig Patientinnen mit demselben Keim. Und GMP treibt die Herstellungskosten in die Höhe. Bislang verfügt in der Schweiz einzig das Universitätsspital Lausanne über ein Labor, das die Anforderungen erfüllt. «Es gäbe durchaus Lösungen», meint Wissenschaftsjournalist Thomas Häusler, der sich seit mehr als 20 Jahren mit Phagen beschäftigt. «Bislang fehlt es in der Schweiz aber an Rückenwind, um sie umzusetzen.»
«Bei seltenen Krankheiten arbeiten Forschende zum Beispiel an Studiendesigns, die auch mit kleinen Patientenzahlen aussagekräftige Ergebnisse liefern sollen – davon könnte man sich inspirieren lassen», sagt Häusler. Ein Blick in Datenbanken zeigt: Weltweit sind 50 klinische Studien zur Phagentherapie verzeichnet, 24 davon laufen aktuell. Keine davon in der Schweiz. Steffi Lehmann, Pharmakologin an der ZHAW, betont die Kosten: «Klinische Versuche sind teuer. Ohne Industriepartner geht es nicht.» Für Firmen wiederum sei die wirtschaftliche Rechnung schwierig. Individuelle Präparate bedeuten hohen Produktionsaufwand bei niedrigem Gewinn. Einige Betriebe mussten bereits wieder aufgeben.
Reisen nach Georgien für die Behandlung
Die Forscherin sieht daher Potenzial bei standardisierten Ansätzen: «Cocktails aus mehreren Phagen gegen häufige Problemkeime könnten zum Beispiel von Apotheken hergestellt werden. Sie wären zwar etwas weniger effizient, aber rasch, günstig und breit einsatzbar.» So läuft es etwa in Georgien, wo die Phagentherapie Tradition hat. Sie ist dort regulär zugelassen, Standard-Cocktails werden regelmässig an aktuelle Problembakterien angepasst. Findet sich kein wirksamer Mix, werden individuelle Formulierungen hergestellt. Obwohl die kontaktierten Fachleute betonen, dass die Qualitätsstandards nicht den heutigen europäischen Vorgaben entsprechen, lockt der einfache Zugang jedes Jahr Hunderte Patienten aus aller Welt zur Behandlung nach Georgien – auch aus der Schweiz.
An der ZHAW wird aktiv an Cocktail-Präparaten geforscht. Eine Hürde ist im Moment ihre Haltbarkeit. So tüfteln Lehmann und Kollegen auch an Strategien mit einzelnen Molekülen, die aus Phagen isoliert werden und gezielt Strukturen von Bakterienzellen zerstören – ein Ansatz, der sich für die industrielle Produktion eignen könnte. Parallel sucht auch die ETH Zürich nach neuen Wegen. Dort werden Phagen genetisch verändert, damit sie gegen ein breiteres Spektrum an Bakterien wirken. Eine klinische Studie zur Behandlung chronischer Harnwegsinfekte mit modifizierten Phagen werde bereits vorbereitet, berichtet Enea Maffei, Postdoktorand im Departement Gesundheitswissenschaften und Technologie.
Weniger strenge Regeln nötig
Für individuelle Therapien setzen Forschende auf internationale Phagenbanken. «Hier werden Stämme katalogisiert und konserviert. Wenn ein Patient an einem multiresistenten Keim erkrankt, lässt sich so relativ rasch herausfinden, ob es schon einen passenden Phagen gibt», erklärt Thilo Köhler, Mikrobiologe an den Universitätsspitälern Genf. Er fand die für Vidal lebensrettende Variante in einer US-amerikanischen Sammlung.
Lars Fieseler von der ZHAW, Präsident von Phage Suisse, fordert deshalb mehr Zusammenarbeit – national wie international. Er betont zudem, dass andere Länder beim Zugang ohne reguläre Zulassung pragmatischer seien: «Belgien und Portugal erlauben massgeschneiderte Phagen auf ärztliche Verordnung, die in einem zentralen Labor nach klaren Qualitätskriterien produziert werden. Die sind zwar weniger streng als GMP, stellen aber sicher, dass die Präparate rein und sicher sind.»
Lehmann ergänzt: «Wenn Standards definiert und eingehalten werden, wäre so etwas auch in der Schweiz denkbar.» Für herkömmliche chemische Arzneimittel, schränkten die GMP bei der Herstellung lebender Organismen wie Phagen zu stark ein. Es brauche angepasste Regeln, so die Forschenden.
In Genf setzt man derweil auf den Aufbau eines gemeinsamen Phagenzentrums Westschweiz. Ziel ist es, die Produktion aus den Sammlungen beider Universitätsspitäler im Lausanner GMP-Labor zu bündeln. Die Gespräche dazu laufen – unklar sind bislang vor allem Logistik und Kosten.
Resistenzkrise nur überwacht statt bekämpft
Damit Swissmedic die Richtlinien lockert, braucht es Druck aus Forschung, Klinik, Politik – und seitens der Zivilgesellschaft. Für Häusler ist das Thema in der Schweizer Öffentlichkeit zu wenig sichtbar. Gemeinsam mit Forschenden organisiert er deshalb das «Forum Phagentherapie », das Betroffene, Expertinnen und Behörden zusammenbringen soll, um Lösungen zu entwickeln und die Debatte anzustossen.
Laut dem Genfer Arzt Van Delden mangelt es auch an politischem Rückhalt. «Es gibt derzeit keinerlei nationale Strategie zu Alternativen zu Antibiotika. Die Resistenzkrise wird nur überwacht statt aktiv bekämpft. » Für ihn stellt sich die Frage: «Welche Prioritäten wollen wir als Gesellschaft setzen? Das Gesundheitssystem ist bereits in der Krise. Sollten wir nicht bestehende, wirkungsvolle Therapien vorantreiben, die Menschen mit hohem Leidensdruck rasch helfen können?»